Bauwissen: Wie Neuroarchitektur unser Wohnbefinden verbessert
Wissenschaftler erforschen, wie mit der Einrichtung und Bauweise eines Gebäudes wir uns in deren Räumen wohler fühlen
Haben Sie sich in einem bestimmten Raum oder Gebäude schon einmal unbehaglich (oder, noch schlimmer: eingesperrt) gefühlt? Vielleicht in einem langen, engen Korridor, der Ihnen das Gefühl gab, nicht entkommen zu können? Oder in einem schwach beleuchteten Zimmer mit niedriger Deckenhöhe? Womöglich kennen Sie aber auch ein ganz anderes Gefühl: Sie gehen durch ein Gebäude, das Ihnen Ehrfurcht und Bewunderung einflößt und ein spontanes Wohlbefinden erzeugt. Wenn Sie schon einmal antike Bauwerke besichtigt haben, wissen Sie, was gemeint ist.
Was ist Neuroarchitektur?
Der Begriff bezeichnet eine neue Fachrichtung, die sich aus zwei sehr unterschiedlichen Disziplinen speist: der Neurowissenschaft und der Architektur. Dabei greifen Forscher auf die Erkenntnisse zurück, die sie über die Funktionsweise des Gehirns gewonnen haben, und wenden sie auf den Zusammenhang mit der baulichen Umgebung an.
„Was Neuroarchitektur ausmacht, ist die Tatsache, dass wir die Gehirnfunktionen mittlerweile sehr gut verstehen. So gut, dass wir brauchbare Schlussfolgerungen auf ihren Zusammenhang mit Architektur und Design ziehen können“, sagt Dr. Colin Ellard, Professor für kognitive Neurowissenschaft an der University of Waterloo in Kanada. Der Wissenschaftler, Sachbuchautor und Berater hat die Reaktionen menschlicher Gehirne und anderer Körperteile auf bestimmte Orte und Räume ausgiebig untersucht.
Der Begriff bezeichnet eine neue Fachrichtung, die sich aus zwei sehr unterschiedlichen Disziplinen speist: der Neurowissenschaft und der Architektur. Dabei greifen Forscher auf die Erkenntnisse zurück, die sie über die Funktionsweise des Gehirns gewonnen haben, und wenden sie auf den Zusammenhang mit der baulichen Umgebung an.
„Was Neuroarchitektur ausmacht, ist die Tatsache, dass wir die Gehirnfunktionen mittlerweile sehr gut verstehen. So gut, dass wir brauchbare Schlussfolgerungen auf ihren Zusammenhang mit Architektur und Design ziehen können“, sagt Dr. Colin Ellard, Professor für kognitive Neurowissenschaft an der University of Waterloo in Kanada. Der Wissenschaftler, Sachbuchautor und Berater hat die Reaktionen menschlicher Gehirne und anderer Körperteile auf bestimmte Orte und Räume ausgiebig untersucht.
Seriöse Wissenschaft – oder der neuste Hype?
Fast alle Bewegungen und „Ismen“ der Vergangenheit wurden durch einen ästhetischen Stil geprägt, hinter dem eine bestimmte Philosophie stand. Demgegenüber beschäftigt sich die Neuroarchitektur weniger mit Architektur selbst als mit den Menschen, die dahinter stehen. „Was wirklich faszinierend an dieser Wissenschaft ist: Wir haben mittlerweile eine Auswahl an Werkzeugen, die zu unglaublich aussagekräftigen Ergebnissen führen. Wir können diese Instrumente nutzen, um physiologische Reaktionen auf bestimmte Räume zu messen“, fasst Ellard zusammen.
Fast alle Bewegungen und „Ismen“ der Vergangenheit wurden durch einen ästhetischen Stil geprägt, hinter dem eine bestimmte Philosophie stand. Demgegenüber beschäftigt sich die Neuroarchitektur weniger mit Architektur selbst als mit den Menschen, die dahinter stehen. „Was wirklich faszinierend an dieser Wissenschaft ist: Wir haben mittlerweile eine Auswahl an Werkzeugen, die zu unglaublich aussagekräftigen Ergebnissen führen. Wir können diese Instrumente nutzen, um physiologische Reaktionen auf bestimmte Räume zu messen“, fasst Ellard zusammen.
Wie lassen sich menschliche Reaktionen auf Räume und Gebäude messen?
Gemeinsam mit anderen Neurowissenschaftlern führt Ellard Studien durch, bei denen die physiologischen Reaktionen der Teilnehmer auf reale Orte oder Räume in einer virtuellen Realität (VR) gemessen werden. „Der Vorteil von VR besteht darin, dass wir jedes denkbare Gebäude simulieren können. Aber es gibt auch einen Nachteil: Selbst wenn die Modelle noch so gut gerendert sind, ist den Leuten klar, dass sie nicht real sind. Wir müssen davon ausgehen, dass ihre Reaktionen nur eine blasse Ahnung davon sind, wie sie auf entsprechende Gebäude in der Realität reagieren würden“, gibt Ellard zu bedenken.
Gemeinsam mit anderen Neurowissenschaftlern führt Ellard Studien durch, bei denen die physiologischen Reaktionen der Teilnehmer auf reale Orte oder Räume in einer virtuellen Realität (VR) gemessen werden. „Der Vorteil von VR besteht darin, dass wir jedes denkbare Gebäude simulieren können. Aber es gibt auch einen Nachteil: Selbst wenn die Modelle noch so gut gerendert sind, ist den Leuten klar, dass sie nicht real sind. Wir müssen davon ausgehen, dass ihre Reaktionen nur eine blasse Ahnung davon sind, wie sie auf entsprechende Gebäude in der Realität reagieren würden“, gibt Ellard zu bedenken.
„Aber in beiden Fällen können wir uns auf eine Reihe bewährter psychologischer Methoden verlassen. Wir stellen eine Menge Fragen und führen viele verschiedene Tests durch. Außerdem arbeiten wir mit kleinen Sensoren, die unsere Testpersonen am Körper tragen. Sie messen die Herzfrequenz, die Körpertemperatur und den sogenannten Hautleitwert, der mit der Aktivität der Schweißdrüsen zusammenhängt und über den Grad der Erregung Aufschluss gibt“, berichtet Ellard. „In einigen Studien messen wir auch die Gehirnströme. Die Daten liefern uns einfache Sonnenschilde, die mit Elektroden besetzt sind. Man kann sie auch auf der Straße aufbehalten und die Augenbewegungen über Spezialbrillen mit kleinen Kameras, die die Pupillen filmen.“
Wie reagieren Gehirn und Körper auf Architektur?
Im Hippocampus-Bereich unseres Gehirns gibt es Zellen, die auf geometrische Informationen und räumliche Organisation spezialisiert sind. Immer wenn Sie in einen Raum, eine Wohnung oder eine andere Umgebung eintreten, sind diese Zellen mit der Navigation beschäftigt. Sie nehmen räumliche Informationen auf und speichern sie in Form kognitiver „Landkarten“.
Ein kleines Experiment macht deutlich, wie das funktioniert: Denken Sie an einen Ort zurück, an dem Sie sich unwohl fühlten und den Sie am liebsten gleich wieder verlassen hätten. Schlug Ihr Herz dort schneller, und atmeten Sie heftiger? Der Auslöser dieser Reaktion war der Hypothalamus in Ihrem Gehirn. Er hat Ihre Nebennieren angewiesen, die „Stresshormone“ Adrenalin und Cortisol freizusetzen.
Im Hippocampus-Bereich unseres Gehirns gibt es Zellen, die auf geometrische Informationen und räumliche Organisation spezialisiert sind. Immer wenn Sie in einen Raum, eine Wohnung oder eine andere Umgebung eintreten, sind diese Zellen mit der Navigation beschäftigt. Sie nehmen räumliche Informationen auf und speichern sie in Form kognitiver „Landkarten“.
Ein kleines Experiment macht deutlich, wie das funktioniert: Denken Sie an einen Ort zurück, an dem Sie sich unwohl fühlten und den Sie am liebsten gleich wieder verlassen hätten. Schlug Ihr Herz dort schneller, und atmeten Sie heftiger? Der Auslöser dieser Reaktion war der Hypothalamus in Ihrem Gehirn. Er hat Ihre Nebennieren angewiesen, die „Stresshormone“ Adrenalin und Cortisol freizusetzen.
Verspürten Sie damals Unruhe und eine gesteigerte Aufmerksamkeit? Das haben Sie diesen Stresshormonen zu verdanken, die Ihre Atemfrequenz erhöht und dadurch Ihr Blut mit Sauerstoff angereichert haben. Hatten Sie in dem Moment Bewegungsdrang und fühlten Sie sich so, als wären Sie auf dem Sprung? Kein Wunder! Denn Ihre Blutgefäße hatten sich zusammengezogen, um das sauerstoffreiche Blut in ihre Muskeln zu pumpen, die sich daraufhin anspannten, um die wahrgenommene „Bedrohung“ abzuwehren (in diesem Fall: um Ihnen zu helfen, so schnell wie möglich aus dem Raum oder dem Gebäude zu flüchten).
Weil unser physiologischer Zustand enorme Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat und wir den größten Teil unseres Lebens in Innenräumen verbringen, spielen „gesunde“ Wohnhäuser, Arbeitsplätze und andere Gebäude eine Schlüsselrolle für unser Wohlbefinden.
Weil unser physiologischer Zustand enorme Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat und wir den größten Teil unseres Lebens in Innenräumen verbringen, spielen „gesunde“ Wohnhäuser, Arbeitsplätze und andere Gebäude eine Schlüsselrolle für unser Wohlbefinden.
Aber reagieren verschiedene Menschen nicht unterschiedlich auf eine Umgebung?
Das ist richtig. Es gibt keine universal gültige Reaktion auf einen bestimmten Raum, und diese Tatsache berücksichtigen die Neurowissenschaftler auch in ihren Forschungen. Es ist sogar noch komplizierter: Unsere ursprüngliche Reaktion auf einen Ort unterscheidet sich oft erheblich von den Reaktionen, die derselbe Ort später auslöst, wenn wir uns an ihn gewöhnt haben.
Dazu kommen die Erfahrungen, die wir in einem Raum machen und die unsere Wahrnehmung zusätzlich beeinflussen. Zum Beispiel wird Ihr Gehirn anders auf einen Raum reagieren, wenn Sie dort eine Jobzusage bekommen haben, als auf einen Raum, in dem Ihnen mitgeteilt wird, dass Sie entlassen werden – auch wenn es sich um denselben Raum handelt. Ellard geht auch davon aus, dass verschiedene demografische Faktoren Einfluss auf unsere Vorlieben haben, zum Beispiel das Alter, der kulturelle Hintergrund und vielleicht auch das Geschlecht.
Das ist richtig. Es gibt keine universal gültige Reaktion auf einen bestimmten Raum, und diese Tatsache berücksichtigen die Neurowissenschaftler auch in ihren Forschungen. Es ist sogar noch komplizierter: Unsere ursprüngliche Reaktion auf einen Ort unterscheidet sich oft erheblich von den Reaktionen, die derselbe Ort später auslöst, wenn wir uns an ihn gewöhnt haben.
Dazu kommen die Erfahrungen, die wir in einem Raum machen und die unsere Wahrnehmung zusätzlich beeinflussen. Zum Beispiel wird Ihr Gehirn anders auf einen Raum reagieren, wenn Sie dort eine Jobzusage bekommen haben, als auf einen Raum, in dem Ihnen mitgeteilt wird, dass Sie entlassen werden – auch wenn es sich um denselben Raum handelt. Ellard geht auch davon aus, dass verschiedene demografische Faktoren Einfluss auf unsere Vorlieben haben, zum Beispiel das Alter, der kulturelle Hintergrund und vielleicht auch das Geschlecht.
„Wie wir feststellen konnten, verändert sich der physiologische Erregungszustand, während man von einem Raum zum anderen wechselt“, sagt Ellard. „Wenn Sie in einen beeindruckend großen, offenen Raum eintreten, wird Ihr Erregungsniveau in der Regel ansteigen. Aber das ist nur die erste Reaktion auf einen Raum, in dem Sie noch nie zuvor waren. Was vermutlich eine größere Rolle spielt, und worüber wir weniger wissen ist, welchen Einfluss hat die Gestaltung einer Wohnung über mehrere Monate oder gar Jahre? Das ist eine wesentlich komplexere Frage, bei der es auf viele Details ankommt. Dieser Frage kommen wir mit unseren Untersuchungen und VR-Modellen nicht ganz so einfach auf die Spur.“
Was suchen wir unbewusst in einem Haus oder einer Wohnung?
Nicht jeder Punkt auf unserer Wunschliste für das perfekte Zuhause leitet sich aus der Biologie ab – aber manche schon, und über die kann uns Neuroarchitektur einiges mitteilen. „Wenn wir uns anschauen, wie Menschen auf gebaute Umwelt reagieren, geht es im Grunde um einen grundlegenden biologischen Prozess, den man ‚Habitatwahl‘ nennt“, erläutert Ellard.
„Nehmen wir die gesamte Entwicklung unserer Evolution ins Auge, dann haben wir ein ähnliches Problem wie ein Fuchs, der einen guten Standort für seine Höhle sucht, oder wie ein Vogel, der ein Nest bauen will. An welchem Ort stehen uns maximale Ressourcen zur Verfügung bei einer möglichst geringen Wahrscheinlichkeit, dass wir einem Fressfeind zum Opfer fallen? Als moderne Menschen müssen wir uns zwar meistens nicht mehr ausdrücklich mit diesen Problemen beschäftigen. Aber solche Faktoren üben immer noch Druck auf uns aus, wenn wir einen Platz zum Wohnen suchen.“
Nicht jeder Punkt auf unserer Wunschliste für das perfekte Zuhause leitet sich aus der Biologie ab – aber manche schon, und über die kann uns Neuroarchitektur einiges mitteilen. „Wenn wir uns anschauen, wie Menschen auf gebaute Umwelt reagieren, geht es im Grunde um einen grundlegenden biologischen Prozess, den man ‚Habitatwahl‘ nennt“, erläutert Ellard.
„Nehmen wir die gesamte Entwicklung unserer Evolution ins Auge, dann haben wir ein ähnliches Problem wie ein Fuchs, der einen guten Standort für seine Höhle sucht, oder wie ein Vogel, der ein Nest bauen will. An welchem Ort stehen uns maximale Ressourcen zur Verfügung bei einer möglichst geringen Wahrscheinlichkeit, dass wir einem Fressfeind zum Opfer fallen? Als moderne Menschen müssen wir uns zwar meistens nicht mehr ausdrücklich mit diesen Problemen beschäftigen. Aber solche Faktoren üben immer noch Druck auf uns aus, wenn wir einen Platz zum Wohnen suchen.“
Welche Dinge bewerten die Menschen in den Experimenten als angenehm?
Weil persönliche Vorlieben ohne Zweifel eine bedeutende Rolle spielen, hält Ellard nicht viel von Pauschallösungen, die für alle gelten sollen. Stattdessen setzt er auf wiederkehrende Motive. „Wir bevorzugen Orte, zu denen wir einerseits Zuflucht nehmen können, die uns also einen gewissen Schutz bieten. Andererseits aber auch, die uns Aussichten bieten, an denen wir die Umgebung im Blick haben und erfahren, was dort vor sich geht“, sagt der Experte. „Sogar die andauernde Beliebtheit von Ohrensesseln könnte damit zu tun haben, dass sie uns beides ermöglichen. In Wohnräumen kann man beobachten, dass Menschen sich zielstrebig auf Nischen zubewegen, die in größere Räume eingebaut sind.“
Weil persönliche Vorlieben ohne Zweifel eine bedeutende Rolle spielen, hält Ellard nicht viel von Pauschallösungen, die für alle gelten sollen. Stattdessen setzt er auf wiederkehrende Motive. „Wir bevorzugen Orte, zu denen wir einerseits Zuflucht nehmen können, die uns also einen gewissen Schutz bieten. Andererseits aber auch, die uns Aussichten bieten, an denen wir die Umgebung im Blick haben und erfahren, was dort vor sich geht“, sagt der Experte. „Sogar die andauernde Beliebtheit von Ohrensesseln könnte damit zu tun haben, dass sie uns beides ermöglichen. In Wohnräumen kann man beobachten, dass Menschen sich zielstrebig auf Nischen zubewegen, die in größere Räume eingebaut sind.“
Ellard betont, dass wir nicht auf einen bestimmten Typus von Wohnraum festgelegt sind. Wichtig ist, dass uns eine gewisse Auswahl zur Verfügung steht. „Mit unseren VR-Modellen konnten wir herausfinden, dass Menschen großzügige, offene Räume bevorzugen, wenn sie mit anderen zusammen sind. Aber wenn sie ein Problem lösen sollen oder komplexe Gefühle zu bewältigen haben, ziehen sie sich gerne in eine kleinräumige, abgeschlossene Umgebung zurück“, berichtet Ellard.
In seinen Forschungen fand Ellard auch heraus, dass Gebäudefassaden einen großen Einfluss auf uns haben. „Wir haben entdeckt, dass symmetrische Fassaden eine stärkere Anziehungskraft auf die Teilnehmer ausüben und sie dazu bringen, höhere Zufriedenheitswerte anzugeben“, so Ellard.
In seinen Forschungen fand Ellard auch heraus, dass Gebäudefassaden einen großen Einfluss auf uns haben. „Wir haben entdeckt, dass symmetrische Fassaden eine stärkere Anziehungskraft auf die Teilnehmer ausüben und sie dazu bringen, höhere Zufriedenheitswerte anzugeben“, so Ellard.
Was der Forscher ebenfalls zeigen konnte: Wir fühlen uns von Fassaden angezogen, die eine komplexe und interessant gestaltete Textur aufweisen. Dagegen stoßen glatte, monotone und wenig abwechslungsreich gestaltete Flächen eher auf Ablehnung. Als er in einem seiner Experimente die studentischen Versuchspersonen an einer langen, dunklen Glasfassade in Lower Manhattan vorbeischickte, offenbarten die Aufzeichnungen, dass bei den Teilnehmern die Stimmung und das Erregungsniveau sanken. Gleichzeitig beschleunigte sich ihre Schrittgeschwindigkeit – ein unbewusster Versuch, die Sache schneller hinter sich zu bringen. „Ich nehme an, das liegt an unserem Verlangen nach Information“, sagt Ellard. „Menschen sind auf Informationen angewiesen, um zu überleben, und eine gewisse Komplexität steht für Information. Das scheint mir die einfachste Erklärung zu sein.“
Der Wissenschaftler vermutet, dass seine Erkenntnisse über die Struktur von Fassaden auch auf die Einrichtung unserer Wohnräume anwendbar sind. „Auch das haben wir ausgiebig in unseren Virtual-Reality-Modellen untersucht. Dort waren die Ergebnisse ähnlich wie bei unseren Feldforschungen im Außenbereich“, so Ellard. Falls Sie noch nie ein großes Faible für minimalistische Einrichtungen hatten: Das könnte ein Grund dafür sein.
IN IHRER NÄHE: Finden Sie Experten für 3D-Visualisierung
IN IHRER NÄHE: Finden Sie Experten für 3D-Visualisierung
Mit seinen Erkenntnissen über gehirngerechte Architektur ist Ellard nicht allein. Einige weitere Beispiele jüngster Forschungen:
- Roger Ulrich, Architekturprofessor in Göteborg (Schweden), hat herausgefunden, dass Krankenhauspatienten früher entlassen werden, wenn ihr Zimmer einen Ausblick in die Natur hat, als wenn sie von geschlossenen Räumen umgeben sind.
- Wissenschaftler am kalifornischen Salk Institute, die mit Architekten zusammenarbeiten, sind gerade dabei, erstaunliche Fakten über unterschiedliche Beleuchtungsarten in Gebäuden herauszufinden. Sie unterscheiden zum Beispiel Morgenlicht (mit höherem Blauanteil) und Abendlicht (mit höherem Rotanteil) von künstlichem Licht und untersuchen die Zusammenhänge zwischen diesen Lichtarten und unseren kognitiven Prozessen.
- Oshin Vartanian, Psychologieprofessor in Toronto (Kanada), konnte nachweisen, dass wir auf Krümmungen in der Architektur positiv reagieren. „Das kann einfach heißen, dass Bauformen mit gekrümmten Linien im Vergleich zu, sagen wir mal, gezackten Linien, uns weniger Schaden zufügen, wenn wir uns ihnen körperlich nähern. Ein weiterer Anpassungs-Mechanismus, der im Lauf der Evolution entstanden ist. Aber ich glaube, das ist längst nicht alles“, sagt Vartanian.
Professor Ellard: „Wir mögen zum Beispiel auch Wege, die in Schlangenlinien verlaufen. Das kommt möglicherweise daher, dass sie etwas zu bieten haben, das in der Umweltpsychologie unter dem Begriff Mystery bekannt ist. Gerne sind wir in Situationen, in denen wir Geheimnisse aufdecken können. Wir mögen Umgebungen, die uns mit dem Versprechen anlocken, dass dort weitere Informationen zu holen sind. Auch hier ist wohl die Suche nach Information das entscheidende Element“, erklärt Ellard.
„Eines der am besten belegten Forschungsergebnisse aus der Umweltpsychologie ist der tiefgreifende Einfluss, den eine natürliche Umgebung auf die psychische und körperliche Gesundheit hat. Schon ein ganz bescheidenes Detail, zum Beispiel eine Zimmerpflanze oder sogar ein Bild, auf dem Pflanzen zu sehen sind, kann eine Wirkung hervorrufen.“ Schließlich wohnten Menschen noch nicht immer in Gebäuden. Als sie ihre primitiven Instinkte allmählich verfeinerten, lebten sie in einer natürlichen Umgebung – kein Wunder, dass ein solches Umfeld noch immer wirksam ist.
„Eines der am besten belegten Forschungsergebnisse aus der Umweltpsychologie ist der tiefgreifende Einfluss, den eine natürliche Umgebung auf die psychische und körperliche Gesundheit hat. Schon ein ganz bescheidenes Detail, zum Beispiel eine Zimmerpflanze oder sogar ein Bild, auf dem Pflanzen zu sehen sind, kann eine Wirkung hervorrufen.“ Schließlich wohnten Menschen noch nicht immer in Gebäuden. Als sie ihre primitiven Instinkte allmählich verfeinerten, lebten sie in einer natürlichen Umgebung – kein Wunder, dass ein solches Umfeld noch immer wirksam ist.
Was sagen Architekten dazu?
Ellard berichtet, seit den Anfängen der neuen Disziplin vor etwa zehn Jahren hätten Architekten „sehr gemischt“ auf deren Ergebnisse reagiert. „Aber mittlerweile gibt es Organisationen wie die Academy of Neuroscience for Architecture. Das ist eine Gruppe von Forschern und Architekten, die sich alle zwei Jahre treffen, um sich über neue Ergebnisse zu verständigen und die Wissenschaft weiterzuentwickeln. Seitdem sind die meisten Architekten zumindest vage mit dem Gedanken vertraut, dass wir neurowissenschaftliche Prinzipien nutzen können, um die Gestaltung von Gebäuden weiterzuentwickeln.“
Ellard berichtet, seit den Anfängen der neuen Disziplin vor etwa zehn Jahren hätten Architekten „sehr gemischt“ auf deren Ergebnisse reagiert. „Aber mittlerweile gibt es Organisationen wie die Academy of Neuroscience for Architecture. Das ist eine Gruppe von Forschern und Architekten, die sich alle zwei Jahre treffen, um sich über neue Ergebnisse zu verständigen und die Wissenschaft weiterzuentwickeln. Seitdem sind die meisten Architekten zumindest vage mit dem Gedanken vertraut, dass wir neurowissenschaftliche Prinzipien nutzen können, um die Gestaltung von Gebäuden weiterzuentwickeln.“
„Viele sind ziemlich begeistert von den Möglichkeiten dieser Disziplin, die sich gerade erst entwickelt. Ich glaube aber, es gibt auch viele andere, jedenfalls habe ich von ihnen gehört und auch schon mit einigen gesprochen, die sehr viel skeptischer sind. Manche machen sich sogar Sorgen, diese Bewegung könnte einen Schritt zurück machen und eine reduktionistische, vielleicht sogar corbusianische Sicht auf Architektur wiederbeleben, die sich in der Vergangenheit als unzulänglich erwiesen hat.“
Wie kann ich Neuroarchitektur zu Hause umsetzen?
Nach Ellard kommt es vor allem darauf an, ein Verständnis für sich selbst zu entwickeln: Wie würde eine bestimmte Raumgestaltung sich darauf auswirken, wie Sie sich fühlen?
„Bis zu einem gewissen Grad hängen die Vorgaben von Ihrer Persönlichkeit ab“, erklärt Ellard. „Wenn Sie zum Beispiel ein ausgeprägt introvertierter Typ sind, werden Sie mit einem großen, offenen Wohnbereich wahrscheinlich nicht allzu glücklich sein.“
Wer eine räumliche Veränderung plant, dem rät der Experte dazu, eine ähnliche Umgebung aufzusuchen und die eigene Wahrnehmung zu schärfen: Wie kommt dieser Raum bei mir an? Was löst er in mir aus?
MEHR ZUM THEMA: Wie gelingt es mir, meine (Wohn-)Träume zu verwirklichen?
Nach Ellard kommt es vor allem darauf an, ein Verständnis für sich selbst zu entwickeln: Wie würde eine bestimmte Raumgestaltung sich darauf auswirken, wie Sie sich fühlen?
„Bis zu einem gewissen Grad hängen die Vorgaben von Ihrer Persönlichkeit ab“, erklärt Ellard. „Wenn Sie zum Beispiel ein ausgeprägt introvertierter Typ sind, werden Sie mit einem großen, offenen Wohnbereich wahrscheinlich nicht allzu glücklich sein.“
Wer eine räumliche Veränderung plant, dem rät der Experte dazu, eine ähnliche Umgebung aufzusuchen und die eigene Wahrnehmung zu schärfen: Wie kommt dieser Raum bei mir an? Was löst er in mir aus?
MEHR ZUM THEMA: Wie gelingt es mir, meine (Wohn-)Träume zu verwirklichen?
„Und wenn Sie eine neue Wohnung suchen oder ein Haus bauen wollen, denken Sie gründlich über Ihre zurückliegenden Erfahrungen mit den Räumen, in denen Sie gelebt haben, zurück. Dadurch erhalten Sie Aufschluss über Lösungen, die zu Ihnen passen“, empfiehlt Ellard.
„Wenn ich Ihnen Sensoren anlege, kann ich sagen, ob Ihre Gehirnwellen nahelegen, dass Sie entspannt und glücklich sind. Wenn ich Ihren Hautwiderstand messe, kann ich ermitteln, ob Sie eher angeregt sind oder sich langweilen. Aber Menschen sind in der Regel ganz gut darin, sich selbst einzuschätzen. Das gelingt umso besser, wenn Sie geduldig auf Ihre Gefühle horchen und Ihrem eigenen Urteil vertrauen.“
Vom „sicheren Nistplatz“ bis zur wohltuenden Wirkung von Zimmerpflanzen: Decken sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse mit Ihren persönlichen Erfahrungen? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!
„Wenn ich Ihnen Sensoren anlege, kann ich sagen, ob Ihre Gehirnwellen nahelegen, dass Sie entspannt und glücklich sind. Wenn ich Ihren Hautwiderstand messe, kann ich ermitteln, ob Sie eher angeregt sind oder sich langweilen. Aber Menschen sind in der Regel ganz gut darin, sich selbst einzuschätzen. Das gelingt umso besser, wenn Sie geduldig auf Ihre Gefühle horchen und Ihrem eigenen Urteil vertrauen.“
Vom „sicheren Nistplatz“ bis zur wohltuenden Wirkung von Zimmerpflanzen: Decken sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse mit Ihren persönlichen Erfahrungen? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!
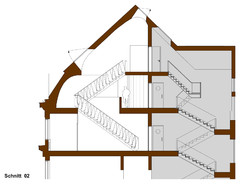



















Die Baumeister des Altertums hatten ein instinktives Gespür dafür, was den Kern von Neuroarchitektur ausmacht – auch wenn sie vielleicht keinen Begriff dafür hatten und ihnen die wissenschaftlichen Werkzeuge fehlten, mit denen wir solche Wirkungen heute messen können. Der Mechanismus aus Gefühlen und körperlichen Vorgängen, mit denen wir auf unsere gebaute Umwelt reagieren, entstand bereits in den Anfängen der Menschheit. Heute beginnen wir, ihn zu verstehen, und erhalten einen immer tieferen Einblick in die Gesetze, die unsere Reaktionen steuern. An diesem Punkt kommt die Neuroarchitektur ins Spiel.